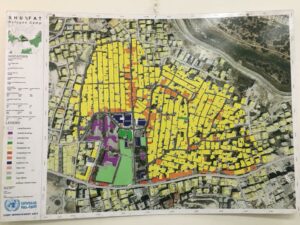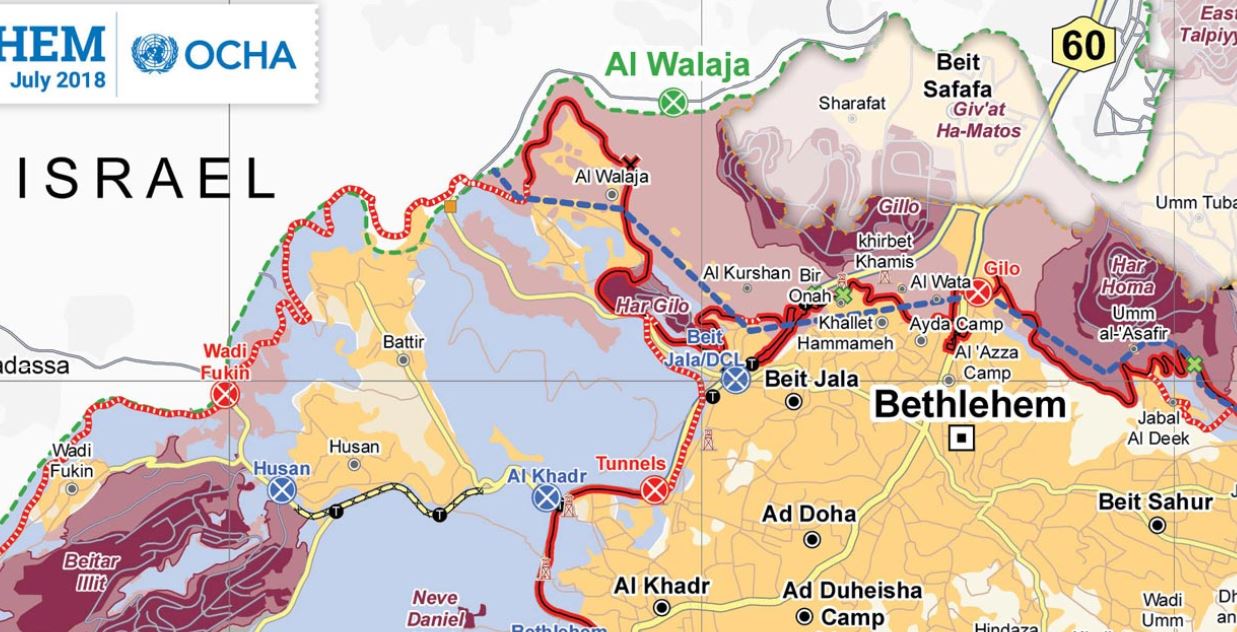Wir EAs (Ecumenical Accompaniers oder Ökumenische Begleiter:innen des Ökumenischen Begleitprogramms in Palästina und Israel des Weltkirchenrats) begleiten am Nachmittag in den South Hebron Hills den Schäfer Hajj Jibrin und seine Herde auf seinem Land in der Gegend des Dorfes Qawawis – und in der Nähe des israelischen Siedlungsaußenpostens Avigayil. Ich bin eigentlich Teil des Teams in Bethlehem und nur für drei Tage auf Besuch im Einsatzort in den South Hebron Hills. Ich genieße den Blick über die Hügel in die weite Landschaft, auf die wilden Pflanzen, die rötliche Erde, die mit verschiedenen Flechten überzogenen Felsen und Steine – und das ruhige, würdevolle Voranschreiten des Schäfers mal hinter, mal inmitten seiner grasenden Schafherde. Auch einige Ziegen sind dabei. Wenn einige Tiere sich zu weit entfernen, hebt er einen der in großer Zahl herumliegenden Steine auf und wirft sie hinter die abseits gebliebenen Schafe – und sie laufen rasch zurück zur Herde. So ziehen wir gemächlich voran, queren auch ein-, zweimal eine schmale Straße. Es ist so friedlich.

Doch wir nähern uns langsam dem Sichtbereich des Außenpostens auf dem Hügelkamm. Nicht mehr weit von der Herde entfernt sehen wir in einer Talmulde – nach wie vor auf dem Land von Hajj Jibrin – frisch gepflanzte Olivenbaumschösslinge, geschützt durch eine grüne Plastikumhüllung. Und wir sehen eine sehr westlich wirkende Zweierschiffschaukel aus Holz. Wir erfahren von Hajj Jibrin, dass die Siedler hier am Werk waren und das Land beanspruchen.
Oben auf dem Hügelkamm tauchen plötzlich drei Gestalten auf und beobachten uns – dann stürmen sie den Hügel hinunter auf uns zu.