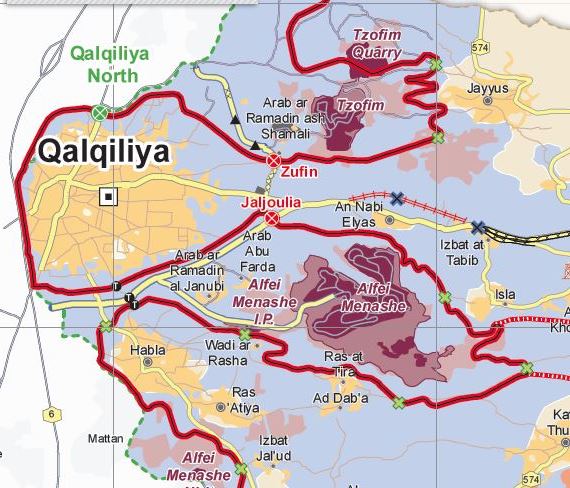Die Gegend von Masafer Yatta ganz im Süden Palästinas ist von unvergleichlicher Schönheit. Wir Ökumenische Begleiter übernachten bei Vollmond und sternenklarer Nacht bei Schäfer Hajj Ali Jabareen in Mantiqat Shib al Butum und genießen die himmlische Ruhe. Kein Siedler hat die Familien in der Nacht gestört wie eine Woche zuvor, nur die Hunde haben um zwei Uhr in angeschlagen und sich dann wieder beruhigt. Um fünf bin ich ausgeschlafen und gehe ins Freie. Ich bin ergriffen von dem atemberaubenden Blick auf das Jordantal bei Sonnenaufgang.

Naturschutz oder Landnahme?

Mitte März erleben wir, wie die Halbwüste erwacht: Krokusse, Iris, Tulpen und Zwerghyazinthen erblühen und gelb überzogen ziehen sich die Getreidefelder in den Tälern dahin. Auf den Weizen- und Haferfeldern stehen Senfpflanzen in voller Blüte. Die Distelart A´koub (lat. Gundelia Tournefortii) wächst hier überall zwischen Steinen und Felsbrocken, zwischen Getreide und Olivenhainen. Solange der Stängel noch saftig ist, kann sie gegessen werden und schmeckt wie Artischocke. Im Frühling wird die Pflanze deshalb schon seit biblischen Zeiten[1] eifrig gesammelt und gekocht. In der gehobenen Küche wird das Wildgemüse sehr geschätzt, der Preis ist hoch: 40 Schekel (11,30€) kostet das Kilo auf dem Markt in Jerusalem, erheblich mehr als das Frühlingsgemüse aus den Gewächshäusern. Für die Bewohner:innen der Beduinendörfer ist der Verkauf dieser Delikatesse eine wichtige Einnahmequelle im Frühjahr.

Anfang März erfahren wir in Susiya, dass tags zuvor Siedler auf palästinensisches Weidegebiet eingedrungen sind und Kindern zwei Körbe voll A´koub entrissen haben, die sie mühevoll gesammelt hatten. Ende März erzählt uns eine Frau aus Jinba, dass ein israelischer Naturschützer von einem Hügel aus regelmäßig die Gegend mit einem Fernglas nach Sammler:innen von A´koub absucht und auch tags zuvor zwanzig Minuten lang auf dem Berg gesessen habe. Falls die Polizei komme, sei eine Strafzahlung von 1.130 Schekel (325 Euro) fällig, da es sich um ein von Israel zum Naturreservat erklärtes Gebiet handele. Israel hat seit 1967 etwa 13% der Westbank zu Naturschutzgebieten erklärt[2]. Seither können Schäfer:innen die Flächen nicht mehr für Weidegänge nutzen, ist das Sammeln von Pflanzen wie A´koub unter Strafe gestellt – und auf diese Weise wird der Druck auf die Menschen in Dörfern wie Jinba größer, ihre traditionelle Lebensweise aufzugeben und anderweitig ihr Geld zu verdienen.